Mit der Statistik ist das im Fußball ja immer so eine Sache. Aber trotzdem.

In den 101 Spielen, die Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft mittlerweile betreut hat, sahen die Männer mit dem Adler auf der Brust 100 Gelbe Karten (Gelb-Rot/Rot = 2 Gelbe). Mein Big-Data-Rechenorakel verrät mir nun: In jedem Spiel seit dem Juli 2006 hat durchschnittlich ein deutscher Nationalmannschaft eine gelbe Karte gezeigt bekommen.
Das ist nicht viel. Im Gegenteil: Das ist sogar sehr wenig. Die aktuelle Kartenstatistik der Bundesliga und 2. Liga zeigt, dass lediglich Dortmund (1,1), Bayern, Wolfsburg (je 1,3) sowie Schalke und der 1. FC Köln (1,4) halbwegs in die Nähe des Löwschen Schnitts kommen. Und hier sind die Gelb-Roten und Roten Karten nicht mal mit eingerechnet.
Auf diesem handelsüblichen Kartenschnitt spielte die DFB-Elf auch in den sechs Spielen nach dem Trainerwechsel 2006 (1,83 Gelbe Karten pro Spiel). Dann sank der Schnitt rapide (2009: 0,63), um sich auf immer noch niedrigem Niveau einzupendeln (2012: 1,07, 2013: 1,36). Es gab Zeiten (2009/2010), da hat die Mannschaft in sechs Spielen eine einzige Karte kassiert.
Ohne die Zahlen vor Löw genau zu kennen, möchte ich behaupten: So wenig gelb war selten. Die Gelbe Karte ist in der aktuellen Spielphilosophie ein unerwünschter Gast, eine Carta non grata quasi. Sie gehört für Löw nicht zum Fußball dazu, sondern ist bei Spielentgleisungen dann eben hinzunehmen. Nägschde Mal müssen wir des anderslösn, gansglar.
Die Nationalmannschaft will den Ball haben und halten und spielen und behalten und damit Tore schießen. Sie will ihn zurückerobern, nicht ihn sich erkämpfen müssen. Dräut am Horizont ein Zweikampf herauf, ist ein kluges Abspiel die erstbeste Option. Das Duell Mann gegen Mann ist potenziell gelbgefährdet und überhaupt risikobehaftet – schließlich könnte der Ball verloren gehen – und von daher zunächst mal die schlechtere Option.
Wie oft saß ich vor dem Bildschirm und habe spieleuphorisiert den ballführenden Germanen angefeuert: „Jau! Und los jetzt! MACH! IHN!! NACKISCH!!!“ Und dann sank ich desillusioniert zurück, weil der Systemspieler den taktisch wertvollen Flachschnellpass wählte. Kein Zweikampf, keine Karthasis, keine Gelbe Karte. Aber ja eben auch: kein Ballverlust.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das moderne 80-Prozent-Ballbesitz-Passfußballspiel manchmal von auch ansonsten durchaus besonnen daherkommenden Menschen einfach nur gehasst wird: Weil diese verfluchten Tikitakerianer einem verdammt nochmal das Meersalz in der Suppe vorenthalten. Die Zweikämpfe. Die dann ab und an zu Fouls und Gelben Karten führen.
So weit, so gut, so nachvollziehbar. In Löws Zeit (101 Spiele) hat die deutsche Mannschaft allerdings ganze 16 Spiele mehr Gelbe Karten als der Gegner erhalten. In jedem sechsten Spiel nur. In keinem der drei wichtigen Spiele der Löwschen Ära (2008 gegen Spanien, 2010 gegen Spanien, 2012 gegen Italien) hat die Mannschaft öfter gelb gesehen als der Gegner.
Und jetzt nochmal zum Anfang: Mit der Statistik ist das im Fußball ja immer so eine Sache. Was bedeuten schon Gelbe Karten? Was bedeuten Durchschnitte, in denen auch Gurkenspiele zählen und Fehlentscheidungen? Was bedeutet eine Gelbe Karte mehr als der Gegner, wenn der nunmal öfter ins Tor trifft? Ja, genau: Im Zweifel jarnüscht.
Aber trotzdem. Sind wir uns einig, dass wir in diversen Spielen von Bedeutung zu ganz bestimmten Momenten Spielaktionen bei den Deutschen vermisst haben, die – wenn es doof läuft – auch zu einer Gelben Karten – Ihgittigitt! – hätten führen können? Wurden diese Aktionen vermieden, weil Gelbe Karten böse und unter jeden Umständen zu vermeiden sind? Sitzt das Löwsche Taktikkorsett zu eng, wenn es mal eng wird? Hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu viel Angst vor Gelben Karten?
Und ich meine damit nicht bösartige Fouls, Schwalben oder alberne Nicklichkeiten. Ich meine ehrliche Zweikämpfe, die mit aller Vehemenz geführt werden, weil da jemand der Meinung ist, jetzt müsste aber mal ein ehrlicher Zweikampf geführt werden. Nicht das ganze Spiel lang, aber manchmal. Und ich schreibe bewusst auch nicht von einem wie auch immer gearteten Klopper vom Dienst, der mal eben Leader spielt, die Fresse aufreißt und in der Gegend umherholzt.
Na ja. Dünnes Eis, ich weiß. Die Mannschaft ist neben Spanien die erfolgreichste Nationalelf der Welt und spielt einen großartigen Fußball. Ihr fehlt ein Titel, aber es gibt Schlimmeres. Ich fände es aber gut, bekäme sie in einem „Spiel um alles“ mal mehr Gelbe als der Gegner – und schösse dann mehr Tore. Das wäre schön.




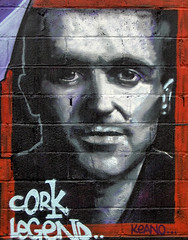

 Wie viele andere Neubrandenburger habe ich heute Post von den Stadtwerken bekommen. Thema: Die Energiepreise für 2014. Und man hat eine „sehr gute Nachricht“ für mich: Der Strompreis bleibt gleich.
Wie viele andere Neubrandenburger habe ich heute Post von den Stadtwerken bekommen. Thema: Die Energiepreise für 2014. Und man hat eine „sehr gute Nachricht“ für mich: Der Strompreis bleibt gleich. 