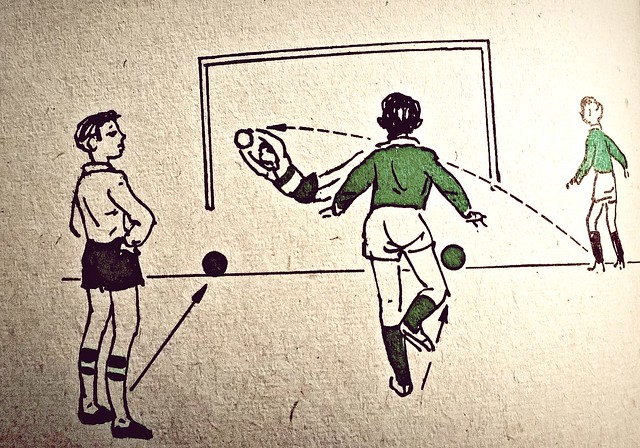Sie leben in einer für uns fremden Gesellschaftsordnung. Dennoch: Wir hatten keine Mühe, uns zu verstehen.
Im Mai 1988 ist ein Filmteam des SWR nach Neubrandenburg gekommen, um Jugendliche in ihrem Alltag zu filmen. Damals lebten hier etwa 85.000 Einwohner, das Durchschnittsalter betrug etwa 30 Jahre, was selbst für damalige Verhältnisse sehr wenig war und Neubrandenburg („eine kleine Großstadt, oder vielmehr eine große Kleinstadt“) zur damals jüngsten Stadt der DDR machte.
Herausgekommen ist der dreiviertelstündige Film „Wir ham’ noch Reserven – Jugendliche in der DDR„, den man in vier Teilen drüben beim SWR ansehen kann. Ohnehin aus zeitgeschichtlichen Gründen sehr interessant, machen den die vielen Bewegtbilder aus dem Neubrandenburg vor 26 Jahren zu einem wahren Schatz für alle, die zu der Stadt und ihren Jugendlichen schon länger einen Bezug haben.
Im ersten Film lernen wir in einem Physik-Kabinett Robert Peters aus der 9. Klasse der POS IX „Dr. Theodor Neubauer“ kennen. Die Leiterin des Polytechnischen Zentrums, Henny Riemer, kommt zu Wort. Gezeigt werden die VEB Gartenbaubetriebe mit ihren vielen Gewächshäusern im Tannenkrug. Und aus der voll retro gekachelten Blumenverkaufsstelle in der Innenstadt strömen erstaunlicherweise fünf Frauen, um die angelieferte Ware entgegenzunehmen.
Der zweite Film beginnt mit einem Einblick in die weite Welt der Jugendmode. Die Verkaufsstellenleiterin Christiane Schafft konstatiert beispielsweise, dass es immer noch große Bedarfslücken und viele Wünsche der Jugendlichen gibt, die sie nicht erfüllen kann, weil schlicht die Produktion nicht hinterherkommt.
Weiter geht’s mit einem Schwenk in den Plattenladen, und … das ist doch der gute, alte Cadillac Record Shop Stargarder Ecke Neutorstraße! Das ist ziemlich kuhl, in dem Schuppen habe ich Mitte der Neunziger mal gearbeitet, aber das ist eine andere Geschichte. Aber sogar meine damalige Chefin, Doris Lange, darf in dem Beitrag als „Objektleiterin Musikalien“ die geringe Auflagenhöhe von West-Lizenzplatten beklagen (ab 3:30). Hallo, Frau Lange, war ’ne tolle Zeit damals! Und ich find’s toll, dass Sie Ihr Markenzeichen, den bunten Lidschatten, über die Wende gerettet hatten. Wenn den jemand tragen kann, dann die Frau Lange, das ist mal klar.
Dann erfahren wir, dass Gärtnereifacharbeiterin Birgit eine Normerfüllung von 108 bis 110 Prozent vorzuweisen hat, wie ein Lehrlingswohnheim von innen so aussieht, warum dort keine Bilder aufgehängt werden durften, wie Outdoor-Kegeln so geht, dass die FDJ-Sekretärin der Lehrlinge ausgerechnet Bärbel Freiheit heißt und wer Heinrich Stiegelmeier ist.
Im dritten Film darf der ehemalige Leiter des Neubrandenburger Sportgymnasiums, Winfried Schneider, als Übungsleiter der Betriebssportgemeinschaft „Aufbau“ den Wert sportlicher Betätigung an sich eloquent lobpreisen. Schneller Wechsel zum Speedway, und prompt erklingt „Born to be wild“, während die Jungs ihre Maschinen zwischen Trabi und Barkas ins Harderstadion schieben. Heute kümmert sich an dieser Stelle die AOK um die Kranken dieser Stadt.
Eine Monika aus Möllenbeck fährt auffem Moped durch die Landschaft, und endlich ist da auch die Omma mit der Dederonschürze im Bild. Wir lernen, dass auch schon früher in den Dörfern nix los war, aber es trotzdem auf dem Land mehr fetzt. Monika reitet schließlich zu „Goodbye Yellow Brick Road“ von Elton John auf dem LPG-Pferd über den Acker.
Und wie sagt der Sprecher aus dem Off danach über den Rummelplatz in der Stadt: „Das Schreierische, Aufdringlich-Laute fehlt hier. Alles geht irgendwie seinen geruhsamen, stetigen Gang.“ Und schließlich: Der Biergarten am Tollensesee, Angeln an der Oberbaumbrücke, Tollensesee-Idylle.
Der vierte Film zeigt Birgit, die eine Wohnung sucht und erklärt, warum es nicht so einfach war, eine zu finden, besonders, wenn man, wie Birgit, ledig war. Schwenk in die Oststadt, Plattenbau galore. Und wieder die sonore Stimme aus dem Off: „Hinter den Fassaden gedeiht bescheidener Komfort: fernbeheizt und preiswert.“ Wir sehen einen der typischen gelben Ikarusse an der Haltestelle „Reifenwerk“; und wie voll die Busse damals waren!
Dann ist es Disco-Zeit im „Mosaik“! Der DJ mit Bommelmütze und Kassettensammlung begeistert die vokuhilalastigen und dauerrauchenden Jugendlichen mit den Pet Shop Boys. Der Rest des Films geht in weiteren Mode-, Tanz- und Frisuren-Flashbacks unter und endet mit dem bemerkenswerten, tiefenpsychologischen Fazit des Sprechers:
Jugendliche in der DDR. So, wie wir sie erlebt haben, erscheinen sie wohlerzogen und angepasst. Nach außen hin folgen sie bereitwillig den Forderungen des Staates. „Nur nicht auffallen“ ist die Devise. Dennoch wird jede Gelegenheit genutzt, ins Private abzutauchen, sich von außen herangetragenen Ansprüchen zu entziehen und die eigenen Interessen auszuleben.“

Dieser Beitrag wäre ohne den Hinweis von dem guten Monaco-Franze nie entstanden. (Was macht überhaupt dein Internet?) Der hatte nach irgendwas gegugelt und war im Neubrandenburg von 1988 gelandet. Fazit: Die Suchmaschine ist der bessere Fluxkompensator.